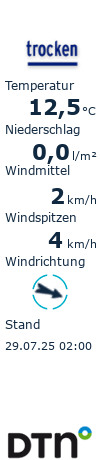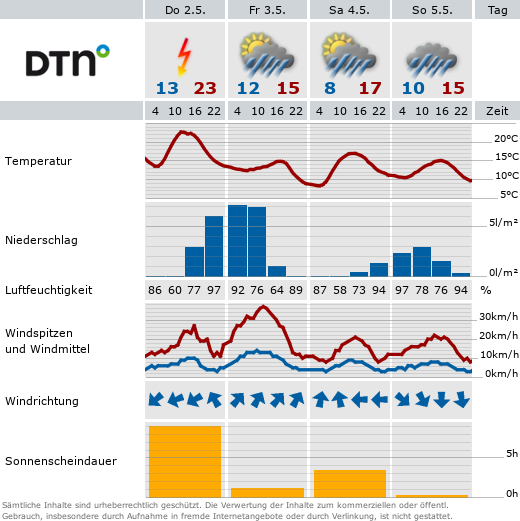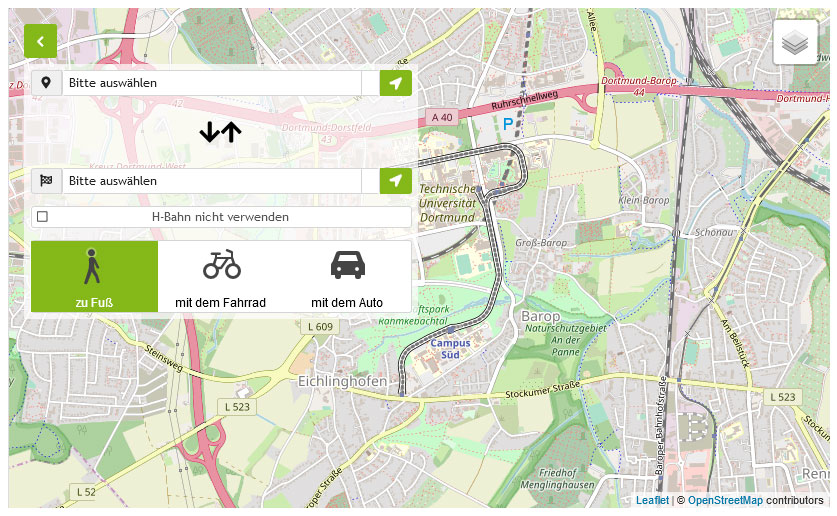Umgang mit Forschungsdaten
Das Forschungsdatenmanagement (FDM) spielt aufgrund von umfangreichen und heterogenen Forschungsdaten durch viele verschiedene Messinstrumente eine zentrale Bedeutung für den Lehrstuhl. Durch FDM-Workshops, die regelmäßig seitens der TU Dortmund angeboten werden, wird die Datenstrategie den Forschenden stetig nähergebracht. Die Integrität und Nachnutzbarkeit unserer Forschungsdaten wird im Sinne der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sichergestellt. Als Teil der TU Dortmund befolgen wir die Grundsätze des Forschungsdatenmanagements an der TU Dortmund, bewahren Forschungserkenntnisse und streben an, diese für zukünftige Forschungsfragen nutzbar zu machen.
Datenbeschreibung
Im Rahmen von Untersuchungen entstehen durch zuvor eingestellte Konfigurations- und Prüfparameter bis hin zu den Ergebnissen sowie aus nachträglichen Analysen verschiedene Rohdaten. Diese liegen entweder in expliziter Form als maschinenlesbare Datenformate aus bspw. mechanischer Prüfung oder in impliziter Form als Bild inkl. Metadaten aus bspw. mikroskopischen Analysen vor. Endgeräte für bildgebende Untersuchungen sind direkt an eine Datenbank geknüpft, um Metadaten vollständig zu berücksichtigen. Die Datenstruktur ermöglicht umfassende Aufbereitungsmöglichkeiten sowie die Nutzung von automatisierten Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Auswertungen von zyklischen Prüfungen sind aufgrund der Hysteresenentwicklung komplex. Ein eigens für die Auswertung der Hystereseschleifen entwickeltes Programm erlaubt als Integration in ein Webtool eine einheitliche Verarbeitung von zyklischen Prüfungen in Kombination mit einer strukturierten Speicherung der Ergebnisse und Rohdaten.
Dokumentation und Datenqualität
Die kontinuierliche Dokumentation aller Rohdaten ermöglicht eine digitale Abbildung jeder Probe. Zusätzliche Messdaten können zur Vervollständigung ergänzt werden. Mit der Verwendung eines digitalen Laborbuchs von elabFTW werden Metadaten erzeugt und mit den jeweiligen Messdaten verknüpft. Allgemeine und ergänzende Informationen werden kollaborativ im Intranet über eine eigene Instanz von MediaWiki oder in Zusammenarbeit mit Angehörigen der TU Dortmund in Confluence organisiert.
Speicherung und technische Sicherung während des Projektverlaufs
Der Austausch der Daten und Ergebnisse zwischen Arbeitsgruppen findet online über den nicht-kommerziellen NRW-Cloud-Speicheranbieter Sciebo statt. Primäre Forschungsdaten werden auf den Mess-/Prüf- und Fertigungsrechnern abgespeichert und anschließend mit den zugehörigen Metadaten optional auf Auswertungsrechner überführt. Diese Datensätze werden auf Servern im Intranet gespeichert. Die Daten werden über ein hochschulübergreifendes Betriebskonzept für Datensicherung von der TU Dortmund auf externe Server in einer Tape-Library gesichert. Projektbezogene Dateien werden zudem gelegentlich auf externe Festplatten abgelegt. Dadurch wird die 3-2-1-Regel der Datensicherung erfüllt. Entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis werden alle erzeugten Daten für eine Dauer von mindestens 10 Jahren gespeichert und gegen unbeabsichtigtes Löschen gesichert.
Rechtliche Verpflichtungen und Rahmenbedingungen
Für den Fall, dass für im Projekt entstehende Methoden Schutzrechte beantragt werden können, wird dies erfolgen.
Datenaustausch und dauerhafte Zugänglichkeit der Daten
Erzielte Forschungsergebnisse werden in internationalen Fachzeitschriften publiziert sowie auf nationalen und internationalen Kongressen dem Fachpublikum vorgestellt. Digitale Forschungsdaten, die zu einer Publikation führen, werden in Form von aufbereiteten Rohdaten nach den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable) gespeichert und bei Bedarf über Repositorien wie Zenodo oder Eldorado von der TU Dortmund anderen Forschenden zur Verfügung gestellt. In Forschungsprojekten werden nach Abschluss jeder Förderperiode die Daten zur Nachnutzung im Rahmen eines Zwischen- oder Abschlussberichts veröffentlicht. Dies erfolgt durch die TU Dortmund in Zusammenarbeit mit dem Team des Forschungsdatenservices.
Verantwortlichkeit und Ressourcen
Die Daten werden durch die Forschungspartner gemeinsam in einer Cloud verwaltet. Im Rahmen von regelmäßigen Besprechungen wird adäquater Umgang mit den Forschungsdaten reflektiert und Verbesserungsmöglichkeiten besprochen. Jede Forschungsstelle ist für die Ergänzung der selbst erzeugten Daten verantwortlich. Es erfolgt eine gegenseitige Überprüfung.